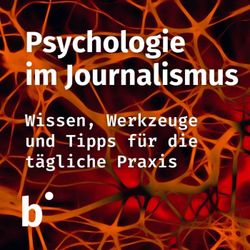Latest episode
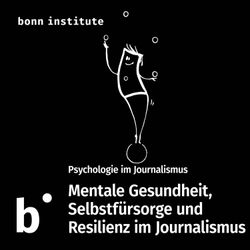
12. Mentale Gesundheit, Selbstfürsorge und Resilienz im Journalismus
55:27||Ep. 12Viele Journalistinnen und Journalisten arbeiten unter stressigen, manchmal gefährlichen Bedingungen und sehen sich regelmäßig mit schwerem menschlichem Leid konfrontiert. In einem solchen Umfeld ist es wichtig, gut auf sich zu achten, um die eigene Gesundheit, Arbeitsmotivation und eine konstruktive Einstellung zu bewahren. Wie das geht, erfährst Du in diesem zwölften und letzten Kapitel unserer Publikation "Psychologie im Journalismus".Mit anwendungsbezogener Forschung, Veröffentlichungen, Veranstaltungen und Fortbildungen trägt das gemeinnützige Bonn Institute dem gestiegenen Bedarf der Medienbranche nach Vernetzung und Wissensaustausch im Hinblick auf konstruktive und nutzerzentrierte Ansätze im Journalismus Rechnung. Ziel ist es, den Journalismus so weiterzuentwickeln, dass er die Interessen der Menschen in den Mittelpunkt stellt – gerade vor dem Hintergrund wachsender gesellschaftlicher Herausforderungen. Den Newsletter des Bonn Institute kannst du hier abonnieren. Credits:Autorinnen: Margarida Alpuim und Katja EhrenbergRedaktion: Peter Lindner, Paula Rösler und Mirella Murri (Bonn Institute)Host: Ellen Heinrichs (Bonn Institute)Produktion: AudiotexTour (audiotextour.de)Leitung: Ellen Heinrichs (Bonn Institute)Kontakt: hello@bonn-institute.org © 2024 Bonn Institute
More episodes
View all episodes
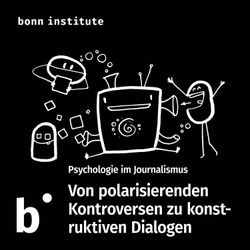
11. Von polarisierenden Kontroversen zu konstruktiven Dialogen
35:33||Ep. 11Journalistinnen und Journalisten berichten fast jeden Tag über Situationen, zu denen es unterschiedliche Sichtweisen gibt. Wenn dies auf eine Art und Weise geschieht, die Spaltungen hervorruft oder fördert, kann dies negative Auswirkungen sowohl auf die Journalistinnen und Journalisten als auch auf ihr Publikum haben. Alternativ dazu können Medienschaffende einen konstruktiveren Ansatz wählen, der darauf abzielt, Lösungen oder gemeinsame Ergebnisse zu finden. In Kapitel 11 der Publikation "Psychologie im Journalismus" konzentrieren wir uns auf die Lehren aus den international anerkannten Harvard Principles of Negotiation sowie darauf, wie sie in die Berichterstattung einfließen können und welche positiven Auswirkungen ein solcher Ansatz hat.Mit anwendungsbezogener Forschung, Veröffentlichungen, Veranstaltungen und Fortbildungen trägt das gemeinnützige Bonn Institute dem gestiegenen Bedarf der Medienbranche nach Vernetzung und Wissensaustausch im Hinblick auf konstruktive und nutzerzentrierte Ansätze im Journalismus Rechnung. Ziel ist es, den Journalismus so weiterzuentwickeln, dass er die Interessen der Menschen in den Mittelpunkt stellt – gerade vor dem Hintergrund wachsender gesellschaftlicher Herausforderungen. Den Newsletter des Bonn Institute kannst du hier abonnieren. Credits:Autorinnen: Margarida Alpuim und Katja EhrenbergRedaktion: Peter Lindner, Paula Rösler und Mirella Murri (Bonn Institute)Host: Ellen Heinrichs (Bonn Institute)Produktion: AudiotexTour (audiotextour.de)Leitung: Ellen Heinrichs (Bonn Institute)Kontakt: hello@bonn-institute.org © 2024 Bonn Institute
10. Psychologische Auswirkungen von Macht: Was Journalistinnen und Journalisten wissen müssen
40:40||Ep. 10Gespräche über Macht erscheinen oft schwarz oder weiß: In manchen Fällen wird Macht mit Unterdrückung in Verbindung gebracht und dann verteufelt. In anderen Fällen wird Macht als ein Mechanismus für Veränderung gesehen, für sich selbst oder für andere. Die psychologische Forschung zeigt, dass Macht im Sinne der Fähigkeit, andere zu beeinflussen (ganz allgemein ausgedrückt), einen positiven Einfluss auf die eigene Wahrnehmung, die Entscheidungsfindung und das soziale Verhalten haben kann. Ob Macht "gut" oder "schlecht" ist, hängt also wie bei vielen Dingen im Leben davon ab, was Du daraus machst. In Kapitel 10 unserer Publikation "Psychologie im Journalismus" zeigen wir, wie Journalistinnen und Journalisten die Erkenntnisse der Forschung zu Macht nutzen können, um bei ihrer Arbeit entschlossenere und einfühlsamere Beziehungen aufzubauen und sich bewusster zu machen, wie Macht die Entscheidungen beeinflusst, die sie bei ihrer Berichterstattung treffen.Mit anwendungsbezogener Forschung, Veröffentlichungen, Veranstaltungen und Fortbildungen trägt das gemeinnützige Bonn Institute dem gestiegenen Bedarf der Medienbranche nach Vernetzung und Wissensaustausch im Hinblick auf konstruktive und nutzerzentrierte Ansätze im Journalismus Rechnung. Ziel ist es, den Journalismus so weiterzuentwickeln, dass er die Interessen der Menschen in den Mittelpunkt stellt – gerade vor dem Hintergrund wachsender gesellschaftlicher Herausforderungen. Den Newsletter des Bonn Institute kannst du hier abonnieren. Credits:Autorinnen: Margarida Alpuim und Katja EhrenbergRedaktion: Peter Lindner, Paula Rösler und Mirella Murri (Bonn Institute)Host: Ellen Heinrichs (Bonn Institute)Produktion: AudiotexTour (audiotextour.de)Leitung: Ellen Heinrichs (Bonn Institute)Kontakt: hello@bonn-institute.org © 2024 Bonn Institute
9. Schluss mit Schubladendenken: Klischees dekonstruieren und vorurteilsfreier berichten
53:21||Ep. 9Es liegt in der menschlichen Natur, andere “in Schubladen zu stecken”, sie zu etikettieren und sich Einstellungen zu bilden, die allein auf der sozialen Gruppenzugehörigkeit einer Person beruhen. Aber Vorurteile machen etwas mit uns. Psychologische Forschung zeigt, dass rassistische und andere Klischees unsere Urteilsbildung und unser Verhalten beeinflussen können, selbst wenn wir überzeugt sind, dass sie nicht stimmen. In Kapitel 9 unserer Publikation "Psychologie im Journalismus" erklären wir, wie Vorurteile entstehen und sich hartnäckig halten können – und wie Journalistinnen und Journalisten durch eine bewusstere und menschenfreundlichere Berichterstattung dazu beitragen können, Polarisierung zu überwinden.Mit anwendungsbezogener Forschung, Veröffentlichungen, Veranstaltungen und Fortbildungen trägt das gemeinnützige Bonn Institute dem gestiegenen Bedarf der Medienbranche nach Vernetzung und Wissensaustausch im Hinblick auf konstruktive und nutzerzentrierte Ansätze im Journalismus Rechnung. Ziel ist es, den Journalismus so weiterzuentwickeln, dass er die Interessen der Menschen in den Mittelpunkt stellt – gerade vor dem Hintergrund wachsender gesellschaftlicher Herausforderungen. Den Newsletter des Bonn Institute kannst du hier abonnieren. Credits:Autorinnen: Margarida Alpuim und Katja EhrenbergRedaktion: Peter Lindner, Paula Rösler und Mirella Murri (Bonn Institute)Host: Ellen Heinrichs (Bonn Institute)Produktion: AudiotexTour (audiotextour.de)Leitung: Ellen Heinrichs (Bonn Institute)Kontakt: hello@bonn-institute.org © 2024 Bonn Institute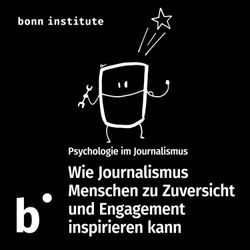
8. Von hilflos zu hoffnungsvoll: Wie Journalismus Menschen zu Zuversicht und Engagement inspirieren kann
27:31||Ep. 8Einer der Gründe, warum Menschen Nachrichten meiden, ist, dass sie sich dabei oft hilflos fühlen. Sie sehen keine Möglichkeiten, etwas zu ändern, und die Informationen haben oft zu wenig Bezug zu ihrem täglichen Leben. Drei psychologische Konzepte – erlernte Hilflosigkeit, Selbstwirksamkeit und Ambiguitätstoleranz – helfen zu verstehen, warum das so ist. In Kapitel 8 der Publikation "Psychologie im Journalismus" erklären wir, warum ein Verständnis dieser Konzepte für Journalistinnen und Journalisten wichtig ist – mit einer Brücke zum Klimajournalismus, einem der Bereiche, in dem sich Menschen oft besonders entmutigt fühlen, was die positiven Auswirkungen ihres Handelns angeht.Mit anwendungsbezogener Forschung, Veröffentlichungen, Veranstaltungen und Fortbildungen trägt das gemeinnützige Bonn Institute dem gestiegenen Bedarf der Medienbranche nach Vernetzung und Wissensaustausch im Hinblick auf konstruktive und nutzerzentrierte Ansätze im Journalismus Rechnung. Ziel ist es, den Journalismus so weiterzuentwickeln, dass er die Interessen der Menschen in den Mittelpunkt stellt – gerade vor dem Hintergrund wachsender gesellschaftlicher Herausforderungen. Den Newsletter des Bonn Institute kannst du hier abonnieren. Credits:Autorinnen: Margarida Alpuim und Katja EhrenbergRedaktion: Peter Lindner, Paula Rösler und Mirella Murri (Bonn Institute)Host: Ellen Heinrichs (Bonn Institute)Produktion: AudiotexTour (audiotextour.de)Leitung: Ellen Heinrichs (Bonn Institute)Kontakt: hello@bonn-institute.org © 2024 Bonn Institute
7. Die Macht des ersten Eindrucks
29:01||Ep. 7Die meisten Journalistinnen und Journalisten überlegen sich genau, wie sie ein Thema einleiten und was ein gutes Schlusswort sein kann. Tatsächlich kann die Reihenfolge, in der über ein Thema berichtet wird, von der anfänglichen Recherche bis zum Endprodukt nicht nur die Sicht des Publikums auf das Thema prägen, sondern auch die Art und Weise, wie Reporterinnen und Reporter selbst darüber denken und es rahmen. In Kapitel 7 unserer Publikation "Psychologie im Journalismus" des Bonn Institute erfährst Du mehr darüber und bekommst Tipps, wie Du Reihenfolgeeffekte bei der Recherche, der Berichterstattung, in Interviews und beim Storytelling bewusst berücksichtigen kannst, um aufschlussreiche und neue Perspektiven auf komplexe Themen zu erhalten.Mit anwendungsbezogener Forschung, Veröffentlichungen, Veranstaltungen und Fortbildungen trägt das gemeinnützige Bonn Institute dem gestiegenen Bedarf der Medienbranche nach Vernetzung und Wissensaustausch im Hinblick auf konstruktive und nutzerzentrierte Ansätze im Journalismus Rechnung. Ziel ist es, den Journalismus so weiterzuentwickeln, dass er die Interessen der Menschen in den Mittelpunkt stellt – gerade vor dem Hintergrund wachsender gesellschaftlicher Herausforderungen. Den Newsletter des Bonn Institute kannst du hier abonnieren. Credits:Autorinnen: Margarida Alpuim und Katja EhrenbergRedaktion: Peter Lindner, Paula Rösler und Mirella Murri (Bonn Institute)Host: Ellen Heinrichs (Bonn Institute)Produktion: AudiotexTour (audiotextour.de)Leitung: Ellen Heinrichs (Bonn Institute)Kontakt: hello@bonn-institute.org © 2024 Bonn Institute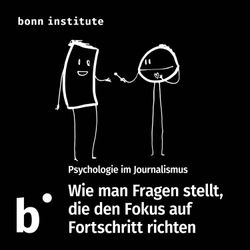
6. Appreciative Inquiry: Wie man Fragen stellt, die den Fokus auf Fortschritt richten
25:49||Ep. 6Als Journalistinnen und Journalisten verbringen wir viel Zeit damit, Fragen über die Welt und die Menschen und Situationen zu stellen, über die wir berichten. Aber sind wir uns wirklich bewusst, welche Auswirkungen die Fragen haben, die wir formulieren? "In dem Moment, in dem wir eine Frage stellen, fangen wir an, Veränderung zu bewirken”: Dies ist einer der Grundsätze von Appreciative Inquiry. Der Ansatz lädt ein, sich auf ressourcenbasierte Fragen zu konzentrieren, die das verstärken, was funktioniert, inspirierende Erzählungen hervorbringen und zu einem nachhaltigen kollektiven Wohlbefinden beitragen. In Kapitel 6 der Publikation "Psychologie im Journalismus" erfahrt Ihr, was Appreciative Inquiry ist, wie der Ansatz für journalistische Interviews genutzt werden kann und warum es dabei überhaupt nicht darum geht, etwas zu beschönigen.Mit anwendungsbezogener Forschung, Veröffentlichungen, Veranstaltungen und Fortbildungen trägt das gemeinnützige Bonn Institute dem gestiegenen Bedarf der Medienbranche nach Vernetzung und Wissensaustausch im Hinblick auf konstruktive und nutzerzentrierte Ansätze im Journalismus Rechnung. Ziel ist es, den Journalismus so weiterzuentwickeln, dass er die Interessen der Menschen in den Mittelpunkt stellt – gerade vor dem Hintergrund wachsender gesellschaftlicher Herausforderungen. Den Newsletter des Bonn Institute kannst du hier abonnieren. Credits:Autorinnen: Margarida Alpuim und Katja EhrenbergRedaktion: Peter Lindner, Paula Rösler und Mirella Murri (Bonn Institute)Host: Ellen Heinrichs (Bonn Institute)Produktion: AudiotexTour (audiotextour.de)Leitung: Ellen Heinrichs (Bonn Institute)Kontakt: hello@bonn-institute.org © 2024 Bonn Institute