Mittelweg 36
All Episodes

38. Was interessiert die Literatursoziologie, Christine Magerski?
38:34||Season 1, Ep. 38Das erste Mal begegnete Christine Magerski der Literatursoziologie während ihrer Schulzeit in der DDR. Ihre intellektuellen Interessen führten sie letztlich nach Kroatien, an den Gründungsort der Zagreber Schule, und zum Begriff der Form. Mit Hannah Schmidt-Ott spricht sie am Beispiel von Dorothee Elmigers preisgekrönten Buch „Die Holländerinnen“ über die Form des Gegenwartsromans, die Relevanz von Gesellschaftstheorie für die Literatursoziologie und das Ende gesellschaftlicher Gestaltbarkeit.Christine Magerski ist Professorin für neuere deutsche Literatur- und Kulturgeschichte an der Universität Zagreb. LiteraturAndreas Reckwitz: „Das Ende der Illusionen. Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne“, Suhrkamp 2019.Dorothee Elmiger: „Die Holländerinnen“, Hanser 2025.Moritz Baßler: „Populärer Realismus. Vom International Style gegenwärtigen Erzählens, C.H.Beck 2022.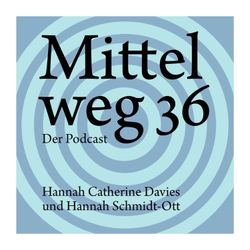
37. Wie patriarchal ist der Rechtsstaat?
34:48||Season 1, Ep. 37Sexuelle Gewalt in der Ehe wurde in Deutschland erst 1997 kriminalisiert. Der Reform des Sexualstrafrechts ging jahrzehntelanger Aktivismus der Neuen Frauenbewegung voraus. Die Kämpfe von Feministinnen, die männliche Gewalt gegen Frauen konsequent anprangerten, analysiert die Historikerin Hannah Catherine Davies in ihrem Buch „Rechtsstaat und Patriarchat“. Mit Hannah Schmidt-Ott spricht sie über die Wahrnehmung sexueller Gewalt in der Bundesrepublik, das Verhältnis der Frauenbewegung zum Staat und Strafe als politisches Mittel.Dr. Hannah Catherine Davies ist wissenschaftliche Oberassistentin am Historischen Seminar der Universität Zürich. Sie forscht zur Geschichte der Gewalt, Geschichte des Kapitalismus, Rechtsgeschichte sowie zu deutscher und amerikanischer Geschichte. „Rechtsstaat und Patriarchat. Eine Geschichte sexueller Gewalt in der Bundesrepublik 1973 bis 1997“ erscheint in der Hamburger Edition.
36. Brauchen wir das Normalarbeitsverhältnis?
46:53||Season 1, Ep. 36Wer von Klassen redet, statt Sozialstrukturanalyse zu betreiben, bekommt eine andere Wirklichkeit in den Blick, meint Nicole Mayer-Ahuja. Dem „Skandal der Klassengesellschaft“ hat sie ihr neues Buch gewidmet. Jens Bisky spricht mit der Arbeitssoziologin über die Lage der arbeitenden Klasse, den Wandel der Arbeitswelt, den schlechten Ruf des Normalarbeitsverhältnisses, Solidarität und Möglichkeiten zur Veränderung.Nicole Mayer-Ahuja ist Professorin für Soziologie in Göttingen. Vor wenigen Wochen erschien im Verlag C.H. Beck ihr Buch „Klassengesellschaft akut – Warum Lohnarbeit spaltet und wie es anders gehen kann“.https://www.hamburger-edition.de/zeitschrift-mittelweg-36/podcast/.....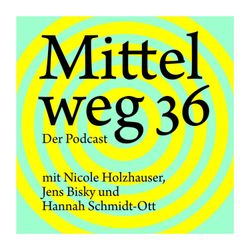
35. Wozu Theorie?
38:21||Season 1, Ep. 35Die soziologische Theorie ist mit einem Gegenstand befasst, der ständigem Wandel unterliegt. Insofern muss auch sie sich beständig weiterentwickeln, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Hannah Schmidt-Ott und Jens Bisky sprechen mit der Soziologin Nicole Holzhauser über studentische Theorieaffinität damals und heute, den Streit um das richtige Konzept, posthumane Soziologie, theoretische Konvertiten und politische Renegaten. Und sie fragen: Hat die Identifikation mit Methoden die Leidenschaft für Theorie abgelöst?LiteraturAndreas Reckwitz: „Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der Moderne“, Suhrkamp 2019.Arlie Russel Hochschild: „The Managed Heart. Commercialization of Human Feeling: Commercialization of Human Feeling“, University of California Press 2012.Bruno Latour: „Das terrestrische Manifest“, Suhrkamp 2018, übersetzt von Bernd Schwibs.Donna Haraway: „Das Manifest für Gefährten“, Merve 2016, übersetzt von Jennifer Sophia Theodor.Pierre Bourdieu: „Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft“, Suhrkamp 1982, übersetzt von Bernd Schwibs und Achim Russer.
34. Politik oder Popkultur?
29:34||Season 1, Ep. 34Was haben US-Präsident Donald Trump und Gangsterboss Al Capone gemeinsam? Eine ganze Menge, meint Georg Seeßlen – vor allem sind sie ein Spiegelbild ihrer Anhänger. Hannah Schmidt-Ott spricht mit dem Autor und Kritiker über das Leben in der Gangwelt, Trump als Meme und die Sprache der Empathielosigkeit. Außerdem geht es um Silvio Berlusconi, Technofeudalismus und Populärkultur als Vorbild sowie Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen.Literatur:Georg Seeßlen: „Trump & Co. Der un/aufhaltsame Weg des Westens in die Anti-Demokratie“, Bertz + Fischer 2025Georg Seeßlen: „Trump! POPulismus als Politik“, Betz + Fischer 2017
33. Was macht Osteuropa?
38:30||Season 1, Ep. 33Die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde ist in Russland als „extremistische Organisation“ gelistet, die Teil einer „antirussischen, separatistischen Bewegung“ sei. Das betrifft auch die renommierte Monatszeitschrift „Osteuropa“. Mit ihrem Chefredakteur, Manfred Sapper, spricht Jens Bisky über die Folgen dieser Einstufung, über die Moskauer Siegesparade am 9. Mai, Putins Erfolge, die Ökonomie des Tötens, die Gründung der Zeitschrift vor hundert Jahren und die Aussichten im Krieg gegen die Ukraine.https://zeitschrift-osteuropa.de/Karl Schlögel, Das russische Berlin. Eine Hauptstadt im Jahrhundert der Extreme, aktualisierte, erweiterte Neuausgabe, Berlin 2019
32. Warum will man Faschismus?
38:21||Season 1, Ep. 32In diesen Tagen lässt sich vielerorts eine Stärkung autoritärer Kräfte beobachten. Doch was macht die Anziehungskraft einer Bewegung aus, die illiberal, antidemokratisch und antiparlamentarisch ist? Faschismustheorien zielen auf die Beschreibung, Erklärung und Kritik faschistischer Tendenzen. Morten Paul und Hannah Schmidt-Ott sprechen über die Ansätze von Gilles Deleuze/Félix Guattari, Georges Bataille sowie Walter Benjamin und fragen, was sie uns über die Gegenwart verraten.Morten Paul ist Literatur- und Kulturwissenschaftler und forscht am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen.Literatur„Das F-Wort“, in: Analyse & Kritik. Zeitung für linke Debatte & Praxis 713 (2025), 18.3.2025.„Faschismus als Lustgewinn“, in: Berlin Review 9 (2025).„Kommentar: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“, in: diffrakting the library/diffrakt. Zentrum für theoretische Peripherie, 10.10.2024.
31. Wie widersteht man?
31:44||Season 1, Ep. 31Es braucht Mut und Beharrlichkeit, um im Alltag das Richtige zu tun, sich gegen Normalisierungszwängen und Konformitätsdruck aufzulehnen. In seinem neuen Buch „Widerstehen“ porträtiert der Soziologe Ferdinand Sutterlüty Menschen, die verdeckten Widerstand in demokratischen Gesellschaften leisten – ob auf dem Mittelmeer, in der Schule oder am Arbeitsplatz. Jens Bisky spricht mit ihm über persönliche Entscheidungen, biografische Konsequenzen und „Versuche eines richtigen Lebens im falschen“.Ferdinand Sutterlüty ist Professor für Soziologie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. „Widerstehen. Versuche eines richtigen Lebens im falschen“ ist in der Hamburger Edition erschienen (208 Seiten, 19 Euro).
30. Was macht Texte schwierig?
37:01||Season 1, Ep. 30Kaum jemand, der sich für das geschriebene Wort interessiert, kennt sie nicht: schwierige Texte, die sich dem unmittelbaren Verstehen entziehen, mit denen man sich herumquält, die Quelle von Freude, aber auch von Frustration sein können. Hanna Engelmeier und Hannah Schmidt-Ott sprechen über unterschiedliche Formen schwieriger Literatur, stilistische und politische Einwände gegen anspruchsvolle Texte. Sie fragen: Was unterscheidet eine schwierige literarische von einer schwierigen theoretischen Schrift? Und welcher Zauber steckt in unzugänglichen Texten?Hanna Engelmeier ist Kulturwissenschaftlerin. Aktuell ist sie Gastprofessorin an der Universität der Künste Berlin.Literatur:Clemens Brentano: „Eingang“, in: „Gockelmärchen“, erweiterte Auflage, Schmerber 1837.Elena Ferrante: „Meine geniale Freundin“, Suhrkamp 2016.Hanna Engelmeier: „Schwierige Texte in Kritik und Vermittlung“, in: Journal of Literary Theory, Band 17, Heft 1, De Gruyter 2023.Juliane Karwath: „Die Droste. Der Lebensroman der Annette von Droste-Hülshoff“, Deutsche Verlagsanstalt 1929.
loading...